Auch wenn die Grenzen mitunter fließend sind, gibt es in unserer nationalen Presselandschaft Kommentare zu Hauf, wohingegen die literarische Gattung des Essays in Deutschland nicht besonders hoch im Kurs steht. Das ist kein Zufall, sondern hat Gründe, wenn auch keine guten.
In einem Essay stellt der Autor Betrachtungen an und schildert dabei seine persönliche Sicht der Dinge. Es geht nicht so sehr um das Was der Erörterung – prinzipiell kann jedes Thema Gegenstand eines Essays sein –, sondern um das Wie. Die Perspektive ist bewusst und gewollt eine subjektive. Hier spricht ein Einzelner aus dem Geist der Freiheit, nicht der Platzhalter einer bestimmten Organisation, einer Ideologie oder einer sonstigen Weltanschauung. Im Vordergrund steht die eigene Sichtweise.
Vielen ist das zu wenig. Sie erwarten eine abgerundete und institutionell, ideologisch oder religiös eingebettete Positionierung, die eine Zuordnung und Kategorisierung des Gesagten erlaubt. Hinzu kommt, dass der oder die Einzelne vielen als zu uninteressant gilt. Im Lande der Dichter und Denker muss es schon etwas Grundsätzlicheres, etwas Repräsentatives, Allgemeingültiges und über den Dingen Stehendes sein, um es überhaupt zu verdienen, zur Sprache gebracht zu werden.
Wer es gerne „grundsätzlich“ mag, erwartet eine erhellende, irgendwie objektive Weltenerklärung, die mehr darstellt als eine bloß persönliche Sicht der Dinge. Es ist kein Zufall, wenn unsere Kommentarlandschaft in nahezu allen öffentlichen Medien von einer Kultur der Weltendeuter, Oberversteher und Sinngeber geprägt ist. Der Grundbass lautet oft genug weniger „ich aber meine“ als vielmehr im Verkündungs- und Urteilsmodus: „ich aber sage Euch“.
Dabei macht es bei bewertenden Betrachtungen einen substantiellen Unterschied, ob jemand sagt „ich meine“ oder aber „das ist so“. In der ersten Haltung ist die Relativierung der eigenen Position eingepreist: Ich meine, aber mir ist klar, dass andere das keineswegs genau so sehen müssen. Dennoch lohnt es sich, darüber zu reden. Denn wo freie Menschen aufeinandertreffen, gibt es keine Alternative zum miteinander reden, wenn es nicht in wechselseitiges Belehren ausarten soll: Das ist so und nicht anders.
Die letztgenannte Haltung sieht sich hingegen oft genug als Protagonist einer höheren Idee und fühlt sich darin erhaben. Respekt vor anderen Sichtweisen ist dabei nicht mitgedacht, sondern es herrscht der Geist des Obsiegens und der Durchsetzung der eigenen Position. Schlimm genug ist insbesondere in vielen sozialen Netzwerken der Ton rotzig, missachtend, manchmal bösartig und hasserfüllt.
Misstrauen gegenüber dem Essay als einer dezidierten Ausdrucksform des Subjektiven erweist sich damit im Kern als Geringschätzung des Einzelnen. Das ist auch deswegen bedauerlich, weil die Form des Essays keineswegs gleichbedeutend mit Beliebigkeit ist. Die Form der subjektiven Haltung bedingt vielmehr gerade die Zurücknahme des eigenen Ichs, daher auch einen Grundrespekt vor anderen Sichtweisen: Ich meine zwar, dass die Dinge so und so sind, ich weiß aber um den Standpunkt meiner eigenen Subjektivität und räume deswegen ein, dass ich mir dessen, was ich sage, im letzten nicht ganz sicher sein kann und dass eine andere, konträre Sichtweise nicht nur möglich, sondern möglicherweise sogar richtiger ist, weil ich etwas übersehen haben könnte. Der Essayist will die eigene Sicht der Dinge zwar entschlossen und selbstbewusst zur Geltung bringen, aber immer auch ein Gespräch anregen. Er besteht nicht auf letzten Wahrheiten, wohl aber auf der Notwendigkeit des Gesprächs.
Das alles ist natürlich nicht neu. Entdeckt und zur Meisterschaft gebracht hat diese Kunstform Michel de Montaigne (1533 – 1592). Er wollte nicht belehren, sondern die Dinge aus seinem Turm heraus betrachten und dies mit anderen teilen. Seine Essays haben eher den Charakter einer Suchbewegung. Darin liegt seine brisante Modernität. Stets spricht er dabei nicht als Kirchenmann, als Vertreter des Staates, als Anhänger einer bestimmten Ideologie oder einer Gruppe, sondern immer als Michel de Montaigne. Er braucht für seine Essays keine ichverstärkenden Autoritäten, um seine Stimme zur Geltung zu bringen. Es genügt völlig die Botschaft: Hier spricht ein freier Mann oder eine freie Frau.
Zumal in einer Zeit, in der feste Ordnungen, Institutionen und Traditionen brüchig geworden sind, in der die Vielfalt der unterschiedlichsten Lebensstile in nahezu allen Lebensbereichen geradezu explodiert und in der die Orientierung für den Einzelnen deswegen nicht gerade einfacher geworden ist, ist das Essay absolut zeitgemäß – aus Respekt vor dem Einzelnen, als Anregung für eigenes Denken und für das Gespräch miteinander, denn „wir mögen auf noch so hohe Stelzen steigen – auch auf ihnen müssen wir mit unseren eigenen Beinen gehen; und selbst auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir nur auf unserm Arsch.“ (Michel de Montaigne). Treffender kann man den Geist des Essays wohl nicht fassen. Beim Essay zählt jede Stimme, weshalb diese Form zugleich urdemokratisch ist. Auch mit Blick auf eine umfassende Krise vieler herkömmlicher Institutionen ist die Rückbesinnung auf die Freiheit des Einzelnen dringend nötig. Gründe genug, wieder mehr Essays zu verfassen. Und darüber zu sprechen.
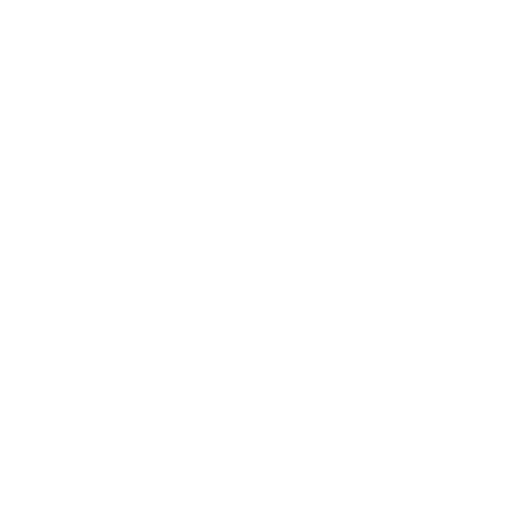
0 Kommentare