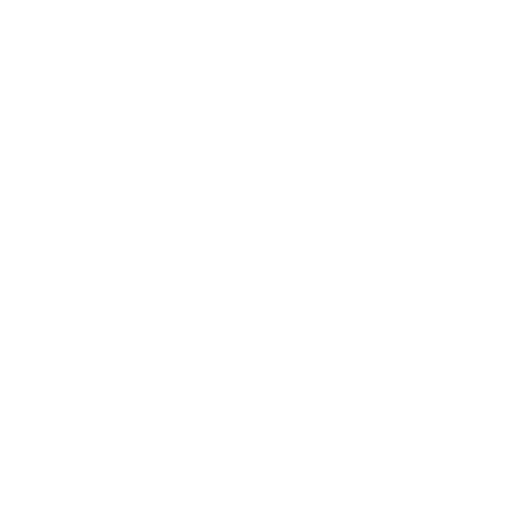von Christof Gramm | Jul 20, 2024 | Allgemein
Wir lernen lebenslang. Aber die Lernkurve und die Art des Lernens sind in unserer Biographie sehr unterschiedlich. Am Beginn des Lebens müssen wir alle enorm viel lernen. Später flacht sich die Kurve ab. Der Lerndruck lässt tendenziell nach. Umso mehr stellt sich die Frage: Was muss, was möchte und was kann ich noch lernen?
Vor allem gegen Ende des Berufslebens, und erst recht danach, gehen unsere Lernpflichten zurück. Lernen wird in dieser Phase immer mehr zu einer selbstbestimmten Angelegenheit. Das rein fachliche Lernen tritt zunehmend in den Hintergrund. Viele genießen diese Freiheit und erweitern ihren Horizont. Manche reduzieren ihre Lernprozesse aber auch auf das lebensnotwendige Minimum. Lernverweigerer gibt es selbst bei älteren Menschen, sei es aus Lernunlust, aus Resignation oder manchmal auch aus Borniertheit. Einige meinen sie hätten ausgelernt. Erstarrung des eigenen Weltbildes, Lebensenge und kommunikative Schäden sind dann vorprogrammiert.
Kann man jenseits des Fachlichen auch das „gute Leben“ lernen? Ich würde mit einem vorsichtigen Ja antworten. Jedenfalls gilt: „Ich lerne, also bin ich.“ Lernen bringt uns näher an die Welt heran und weitet unser Ich. Im Unterschied zu einer passiven Konsumhaltung braucht es dafür Offenheit und den Willen zur aktiven Weltaneignung. Neugierde und Weltenhunger, aber auch eine Portion Ausdauer gehören dazu.
Allerding ist Motivation nicht alles. Lernwilligkeit und Lernfähigkeit sind zweierlei. Gerade ältere Menschen fühlen sich durch technische Entwicklungen oft überfordert. Bei PC, Internet und Handy stößt der gute Wille schnell an Grenzen. Das wirft die Frage nach den möglichen Sinnrichtungen von Lernen auf. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier – jenseits aller spezifischen Fachlichkeit – einige Grundrichtungen, die sich teilweise auch überschneiden:
- Häufig geht es um den Erwerb von praktischen Fähigkeiten. Das gilt nicht nur für technische Fertigkeiten oder für Freizeithandwerker, sondern etwa auch bei sportlichen Aktivitäten. Wer selbst segeln möchte, muss allererst mal segeln können. Auch wer in der Küche, an der Börse oder im Garten mitmischen will, muss Grundkenntnisse besitzen. Es gibt kaum ein Lebensfeld, auf dem man keine praktischen Kompetenzen braucht, um mitspielen zu können.
- Manchmal liegt der Schwerpunkt weniger auf dem praktischen Tun als auf einem gesteigerten Weltverstehen. Alles, was traditionell mit dem Begriff Bildung belegt ist, fügt sich in diese Sinnrichtung. Eine Fremdsprache lernen, Kunst, Musik und Literatur, Geschichte, Philosophie und Politik, Gesellschaft und Moral, naturwissenschaftliche Entwicklungen und technischer Fortschritt gehören dazu. Auch Reisen in fremde Welten, sofern sie sich nicht in bloßem Konsum erschöpfen, können Teil eines Lernprojektes zur Erweiterung des eigenen Weltverständnisses sein.
- Lernen kann aber auch eher existenziell nach innen gerichtet sein und auf Selbsterkenntnis und Selbstverortung zielen. Dabei geht es nicht nur um Psychologie und um soziales Lernen. Beispielhaft für diese Haltung steht Michel de Montaigne, der mit seinen Essays die moderne Form der Selbstreflexion begründet hat. Wer bin ich, was mache ich eigentlich hier, was sind meine Aufgaben? Dabei geht es um Orientierung in der Welt. Zu dieser Sinnrichtung zählt auch das religiöse Lernen, bei dem es um das Verständnis und die Vertiefung der göttlichen Dimension in unserem Leben geht, beispielsweise im Gebet oder mittels Meditation.
Lernintensität und Anforderungsniveau sind ebenfalls ein zentrales Thema. Es ist nicht immer einfach, sich auf neue Welten einzulassen. Gerade wenn man in einem Fach richtig gut ist, fällt es manchmal schwer, sich vom Profi auf die Stufe des Anfängers zu begeben. Wer erst mit 60 Klavierspielen lernt, wird schwerlich ein großer Pianist. Aber muss man das überhaupt? In einer Leistungsgesellschaft können maximale Anstrengung und Überbietungswettbewerb leicht zum Selbstzweck werden. Umso mehr stellt sich die Frage: Geht es beim Lernen um Perfektion oder doch eher um die eigenen Weltzugänge und um Selbstwirksamkeit? Ich meine, es macht frei, nicht unbedingt ein Profi sein zu müssen. Perfektionismus kann eine Falle sein. Die Figur des fröhlichen Dilettanten wird vollkommen unterschätzt.
Was möchten wir in der uns verbleibenden Restlaufzeit noch lernen? Spontan oder geplant: Jedes Lernen, ob eher praktisch, eher kulturell oder eher existenziell ausgerichtet, setzt eine Haltung des Hinhörens, des Hinsehens und des Verstehenwollens voraus. Man muss sich auf die Dinge einlassen, um sich neue Welten zu erschließen. Wohin geht unsere ganz persönliche Reise? So oder so, es gibt noch viel zu lernen. Bis zum Schluss. Gott sei Dank.
von Christof Gramm | Jun 6, 2024 | Allgemein
Wieviel Luxus verlange ich vom Leben, was steht mir zu und was nehme ich mir? Dafür gibt es keine Einheitsformel. Immerhin kann man sagen, dass Wohlstand, Luxus, und Genuss in enger Beziehung zueinanderstehen. Luxus zielt stets auf mehr als nur auf das, was wir zum Leben benötigen. Regional, kulturell und gesellschaftlich wird die Latte, wo der Luxus anfängt, wohlstandsabhängig natürlich sehr unterschiedlich hoch gehängt. Gutsituierte Westeuropäer haben eine völlig andere Vorstellung davon als Menschen in armen, unsicheren und klimatisch menschenfeindlichen Regionen der Welt. Auch individuell existieren sehr unterschiedliche Vorstellungen. Häufig wird Luxus mit einem hedonistischen Lebensstil in Verbindung gebracht. Luxus zielt dann vor allem auf materielle Größen und auf Überfluss, so wie im Bild vom Schlaraffenland, auf Pracht oder auf das ganz Besondere, zum Beispiel kostbare Autos, erlesene Weine, teure Designerkleidung oder Bilder von berühmten Künstlern. Für andere wird Luxus eher durch immaterielle Güter definiert, etwa durch Zeit und Muße oder durch die Freiheit, ein selbstbestimmtes und sorgloses Leben in Gesundheit und Beständigkeit zu führen. Nicht nur die materiellen, sondern auch viele immaterielle Luxusgüter sind allerdings meistens nur auf der Grundlage von Wohlstand zu haben. Jeglicher Luxus hebt uns über Mangel, Notwendigkeit und Alltäglichkeit hinweg. Es geht um das, was man zum Leben nicht unbedingt braucht, was das Leben aber besser, genussvoller und schöner macht. Luxus veredelt den Alltag. Er kann aber auch zur Droge werden und süchtig machen.
Beim Thema Luxus schwingen häufig noch andere Aspekte mit, zum Beispiel soziale Abgrenzung und Wettbewerb. „Ich kann es mir erlauben, du nicht.“ Wir erinnern uns an die Sparkassenwerbung „Mein Haus, mein Boot, mein Auto“. Wer macht die tollsten Reisen, aber auch wer hat die meiste freie Zeit? Luxus bietet die Möglichkeit, sich demonstrativ abzuheben und dadurch soziale Anerkennung zu verschaffen. Was sich alle leisten können und was alle haben, ist kein Luxus mehr und schon gar nicht exklusiv. Wenn jeder nach Mallorca reist, ist das lediglich Standard. Der Gewöhnungseffekt greift auch hier: gestern Luxus, heute schon Normalität, und zwar gleichermaßen bei materiellen und immateriellen Gütern. Für die Fortschreibung des Wohlgefühls von Luxus braucht es mehr. Die Steigerungsspirale ist nach oben hin offen, was die Frage aufwirft, wieviel Luxus tut mir – und anderen – gut?
Manche üben Verzicht und bescheiden sich ganz bewusst, auch wenn sie sich Luxus durchaus leisten könnten. Ein asketischer Lebensstil lehnt insbesondere materielle Luxusgüter als überflüssig und häufig auch als moralisch verwerflich ab. Luxus bedeutet für Asketen, vorausgesetzt sie wollen damit nicht lediglich ihren Geiz übertünchen, die Ablenkung vom Wesentlichen. Bei anderen Luxuskritikern spielt die Frage nach der gerechten bzw. ungerechten Vermögensverteilung eine große Rolle. Sie verurteilen es, dass einige sich viel leisten können, andere dagegen gar nichts. Auch in der christlichen Tradition gibt es eine ganze Reihe von luxusfeindlichen Traditionslinien, zum Beispiel bei Franziskanern oder bei Calvinisten: Luxus ist unmoralisch und sündhaft, weil er andere ausschließt oder weil er das vorhandene Vermögen einfach nur verschleudert oder weil er (umwelt-) schädlich ist.
Das andere Extrem bilden entschlossene Luxusjäger. In einem luxuriösen Leben bildet sich ihre Persönlichkeit ab. Erst recht in einer Weltanschauung, die die Gier als Tugend begreift, so wie dies bei einigen Wirtschaftsideologien der Fall ist, geht es um die Steigerung der Luxussymbole und der Genüsse. Das Streben nach Luxus gilt hier in keiner Weise als moralisch fragwürdig, sondern, ganz im Gegenteil, als Tugend und als persönlich sinnerfüllend. Die Wirtschaft unterstützt das. Sie profitiert davon, wenn sich nicht jeder nur mit dem Standardmodell zufriedengibt. Außerdem spiegeln sich in einem sichtbar zur Schau getragenen Luxus für viele Erfolg, Einfluss und soziale Geltung. Im konkreten Fall kann das zu ziemlich seltsamen Erscheinungen führen, zum Beispiel wenn man sich vergoldete Steaks servieren lässt. Neu ist das trotz mancherlei Empörung nicht. Man muss dafür gar nicht in die Antike zurückgehen. Auch in der Groß- und Urgroßelterngeneration war das mit Blattgoldstückchen versetzte Danziger Goldwasser Luxus pur.
Diese beiden Extreme zeigen, dass die Einstellung zum Luxus viel mit der eigenen Lebenshaltung und der Frage zu tun hat, wie man sich selbst definiert. Manche verurteilen ihn, andere schätzen ihn zwar, begegnen ihm aber eher misstrauisch, wollen sich vielleicht auch nicht abhängig davon machen. Sie gönnen sich von Zeit zu Zeit gerne etwas, halten aber einen Sicherheitsabstand ein. Für wieder andere ist ein luxuriöses Leben absolut wichtig und sinnstiftend.
So oder so, auch hier gilt: Luxus ist Charaktersache. Wie halten wir es damit?
von Christof Gramm | Mai 5, 2024 | Allgemein
Eine Party in einem teuren Club, ein Lied, Ausländer raus, ein paar Bilder, stilisiertes Hitlerbärtchen. Hoch schlagen die Empörungswellen. Tut man den jungen Leuten in diesem kurzen Video unrecht, weil sie beim Feiern vielleicht nur etwas über die Stränge geschlagen sind? Schauen wir genauer hin. Wir sehen junge Leute, ausgelassen, heiter und beschwingt, keine brutalen Dumpfbacken, keine abstoßenden Naziopas, keine gewaltbereiten Kämpfer. Ein bisschen schnöselig, aber naja. Ein Problem ist der Drehort Sylt. Das gleiche Lied in einer Vorstadtkneipe, auf irgendeiner Kirmes in der Provinz oder im Osten unseres Landes löst keine Wellen öffentlicher Empörung aus. Anders im Nobeltreff. Tatsächlich bleibt das Bild verstörend. Genau genommen sehe ich, ohne jede rechtliche Würdigung, vier Bilder.
Erste Bildeinstellung: „Schampusnazis“. Überheblichkeit, die sich auf den eigenen Wohlstand gründet, wo immer er auch herkommen mag, getragen von der Grundüberzeugung: Das haben wir uns alles verdient und das steht uns zu. Uns geht´s prima, da können wir es uns auch mal erlauben „Ausländer raus“ zu singen. Ist doch lustig. Wir sind wir, uns gehört dieses Land. So weit, so bekannt. Diese Art des Selbstvertrauens stößt ab. Eine Ursache für die Empörungswelle dürfte die Wut auf die Überheblichkeit dieser Sorte von Reichen sein.
Zweite Bildeinstellung: Erschreckende ökonomische Dummheit, und damit einhergehend akuter Realitätsverlust. Wohlstand schützt vor Blödheit nicht. Unsere Wirtschaft ist in allen Bereichen auf Ausländer angewiesen. Ohne Ausländer liefe in unserem Land, in dem ohnehin vieles nicht gut läuft, gar nichts mehr. Krankenpflege, Bauarbeiten aller Art oder Verkehrssysteme, um nur ein paar Beispiele zu nennen, würden komplett zusammenbrechen. Wir brauchen Ausländer dringend, und selbst bei der Bundeswehr denken manche über ausländische Soldaten nach. Wie dämlich muss man sein, um das nicht zu sehen?
Dritte Bildeinstellung: Moralische Verwahrlosung. Moralisch feste Koordinaten fehlen hier offensichtlich. Entgrenzungen erleben wir derzeit einige. Rassismus wird wieder hoffähig, nicht nur auf Sylt, was vor allem durch eine politische Partei verbreitet wird. Ausländer raus heißt im new speak dieser Leute Remigration. Und Antisemitismus – keinesfalls zu verwechseln mit Kritik am Staat Israel – kommt bei einigen auch wieder in Mode. Die Zukunft wird für diese Leute durch eine zwar nicht neue, aber doch ganz andere Moral definiert: „Deutschland den Deutschen.“ Wie geht es jetzt weiter? Nach der ersten Welle kollektiver Empörung – ob das Verbot des missbrauchten Liedes wirklich hilfreich ist, wird sich zeigen – setzt jetzt im öffentlichen Diskurs ein anderer Reflex ein: Die Empörung über die Empörung. Man liest über „maximalen Ausschlag auf dem Empörometer“ und über „bundesrepublikanische Rudeldresche“. Manche wittern Hysterie, Hordendynamik oder ein Abladen von kleinkariertem Neid gegen die Reichen. Andere beklagen die moralischen Ungleichgewichte dieser Empörungswelle, also dass die öffentliche Aufregung in mindestens ebenso wichtigen Fällen ausbleibt, zum Beispiel bei antisemitischen Vorfällen oder bei islamistischen Verbrechen.
Jenseits solcher Eingrätschungen bleibt ein hässlicher Sachverhalt übrig. Es geht um Leute, die es eigentlich besser wissen sollten. Privilegierte, die die Grundlagen unseres Gemeinwesens (Kurzform: Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz) absichtlich oder, was auch nicht viel besser ist, in gedankenlosem Amüsiermodus über Bord werfen. Empörungsrituale alleine helfen zwar nicht, aber Entschiedenheit und eine klare Linie gegen solche Verwerfungen schaden unserem Land keineswegs. Das gilt nach innen und außen. Wie wichtig eine klare Grenze zu allem nazinahen Denken ist, zeigt im Übrigen, dass selbst rechtsextreme Parteien aus unseren Nachbarländern im Europaparlament die Zusammenarbeit mit der AfD trotz ansonsten bestehender Gemeinsamkeiten aufkündigen. Wer unsere Vergangenheit ausblendet, disqualifiziert sich auch in Europa. Daran hat sich nichts geändert. Das öffnet den Blick auf die vierte Bildeinstellung: Historische Ignoranz. Wer glaubt, er könne in unserem Land auf einer Party von Schönen und Reichen mit lockeren Sprüchen mal eben einen raushauen, der irrt. Man muss wissen, woher man kommt, in welchem moralischen und historischen Kontext man lebt und wofür man steht. Gilt nicht nur im Nobeltreff, aber jedenfalls auch da.
Eine ganz andere Frage ist es, ob die „öffentliche Hinrichtung“ der Betroffenen in den sozialen Netzen gerechtfertigt ist. Auch Idioten haben Rechte. Die Bilder waren nicht anonymisiert. Hier werden Personen regelrecht vernichtet, auch Namen sollen geteilt worden sein. Auf die spätere strafrechtliche Bewertung kommt es da schon gar nicht mehr an. Und von den sonst so sensiblen Datenschützern hört man auch nichts. So übel der Anlass, an dem es nichts zu beschönigen gibt, auch ist: Das ist eine Schieflage, und diese Schieflage besteht unabhängig vom konkreten Fall. Sie betrifft uns in Wahrheit alle. Unserer Freiheit tut man damit keinen Gefallen.
von Christof Gramm | Apr 10, 2024 | Allgemein
Glück oder Unglück im Leben – alles nur Zufall? „Es gibt keinen Zufall“, so lautete die Formel meines schon in den 1970er Jahren irgendwie aus der Zeit gefallenen Deutschlehrers. Auch gläubige Menschen sehen das mitunter so. Wo alles, und sei es auf noch so verschlungenen Wegen, auf einen göttlichen Plan zurückzuführen ist, mag es zwar einen signifikanten Mangel an menschlicher Erkenntnis geben, aber keinen Zufall. Uns Heutigen fällt es hingegen schwer, an einen zufallsbereinigten göttlichen Weltenplan zu glauben. Trotzdem mögen wir den Zufall nicht. Dafür gibt es Gründe.
Der Alltagserfahrung entspricht es zunächst, dass die Welt uns oft im Zufallsmodus begegnet. Das ist nicht immer angenehm. Heute spricht man dabei allerdings eher von Kontingenz. Dabei geht es um die Erfahrung der Beliebigkeit, um verwirrend viele Möglichkeiten und um die Unberechenbarkeit des Lebens. Alles könnte so oder so, oder doch auch ganz anders sein. Im Möglichkeitsmodus zu existieren ist anstrengend. Darin ist das Unheimliche, Verstörende und Beunruhigende des Zufalls noch aufbewahrt. Denn hinter der Einsicht in die Zufälligkeit der Existenz lauert in Wahrheit stets die Angst. Wo der Zufall als solcher erkannt wird und zuschlägt, ist Schluss mit Selbstwirksamkeit (früher benutzte man dafür gerne das Wort Selbstverwirklichung), und zwar selbst dann, wenn es gut geht. Bei Lichte betrachtet ist der Zufall eine narzisstische Kränkung, denn wenn letztlich der Zufall über mein Glück oder Unglück, über meinen Platz im Leben, über Gelingen und Misslingen entscheidet, macht mich das hilflos. Am besten wissen das vielleicht die suchthaften Spieler. Wo der Zufall regiert, ist es immer möglich zu gewinnen. Genau darauf hoffen alle Spieler, gegen alle Vernunft.
Im Unterschied zum altmodisch religiösen Menschen und zum Spieler setzt der moderne Mensch auf die Überwindung des Zufalls aus eigener Kraft. Die Erfahrung des Ausgeliefertseins an ein nicht planbares Schicksal steht im radikalen Gegensatz zum modernen Streben, das Leben in all seinen Bezügen zu beherrschen und zu gestalten. Zufall bedeutet dagegen Kontrollverlust. Es gilt deswegen, im eigenen Leben nichts dem Zufall zu überlassen. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Am gängigsten dürfte die moderne Leistungsideologie sein. Nach Michael J. Sandel ist es geradezu ein Kennzeichen von Wohlstandseliten, dass sie ihren Erfolg vor allem auf ihre eigene Leistung zurückführen und dabei das Zufällige ihrer eigenen günstigen Lebensposition ausblenden. Sie sind der Meinung, dass ihr Erfolg ihnen aufgrund ihrer Leistung unbedingt zustehe. Diese Form des Leistungsdenkens hat tiefe Wurzeln und ist keineswegs auf die Wirtschaft beschränkt, sondern sie erfasst alle Weltbezüge. Wohlstand, Status, Gesundheit und selbst jede Form von Sinn sind für den modernen Menschen in erster Linie Produkt seiner eigenen Anstrengung. Gelingen, Glück und Erfolg sind für ihn gerade nicht zufällig, sondern die wohlverdiente Konsequenz des eigenen Handelns. „Jeder ist seines Glückes Schmied“. Das macht nicht nur selbstbewusst, sondern es zieht der Macht des Zufalls auch den Stachel: Leistung besiegt Schicksal.
Im Umkehrschluss heißt das allerdings auch, wer es nicht schafft, ist selbst daran schuld. Unglück und Leid sind in der Leistungsideologie nicht zufällig verteilt, sondern konsequente Zuweisungen aufgrund eigenen Handelns. Von den Wohlstandseliten gerne übersehen wird dabei die Zufälligkeit der eigenen Start- und Lebensbedingungen. Der Zugang zu lebenswichtigen Gütern, zu Bildungschancen, zu Gesundheit, zu sozialen Kompetenzen und natürlich zu Vermögen und vielem mehr sind von Anfang an völlig ungleich verteilt. Der eine wird ohne eigenes Verdienst in eine reiche Existenz hineingeboren, die andere in ein hoffnungsloses Umfeld ohne die Chance eines Ausweges. Manches ist im historischen Schnitt zwar besser geworden, aber im Kern bestimmt der Zufall immer noch die Existenz. Nun wäre es vollkommen utopisch, die Startbedingungen der Menschen auf null setzen zu wollen. Darum kann es nicht gehen. Aber wo das Bewusstsein für die Zufälligkeit auch der eigenen menschlichen Existenz fehlt, fehlt nicht nur eine grundlegende Voraussetzung für die Solidarität der Starken mit den Schwachen. Leider stehen dadurch auch die Bedingungen gut, menschliche Monster hervorzubringen, die sich durch Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit und den unbedingten Willen zu grenzenlosem Spaß und Genuss definieren. Wer den Zufall im eigenen Leben nicht erkennt und nicht anerkennt, und zwar gerade auch dann, wenn das Schicksal es gut mit einem meint, wird mit Demut, mit Bescheidenheit, Dankbarkeit und mit einem Gefühl der Verpflichtung für andere, die weniger Glück hatten, nichts anfangen können. Selbst im Lande der „unbeschränkten Möglichkeiten“ war diese Selbstbindung der Eliten einmal prägend, wofür zum Beispiel der Name Andrew Carnegie steht.
Ich meine, es ist grundverkehrt, den Zufall bezwingen zu wollen. Die Einsicht in die Zufälligkeit unserer eigenen Existenz ist nichts, was es zu überwinden gilt, ganz im Gegenteil. Sie zeigt uns, dass wir vieles nicht im Griff haben, und sie kann uns bescheidener, mitfühlender und menschlicher machen. Wir brauchen dringend mehr Respekt vor dem Zufall!
von Christof Gramm | Mrz 18, 2024 | Allgemein
Unsere „innere Brille“ prägt unsere Sichtweise auf die Welt. Zu oft richtet sich der Blick dabei auf Negatives. Das färbt wiederum nach innen ab und fühlt sich dann so an: Das Wirkliche, beziehungsweise das, was wir für wirklich halten, ist das Negative. Die Themen und die Art und Weise, wie öffentliche Medien über unsere aktuelle Wirklichkeit berichten, lädt zu dieser verzerrten Perspektive regelrecht ein. Klimawandel, Kriege, Krankheiten und Katastrophen aller Art bilden dabei nur die Spitze des Eisberges. Bilder des Leidens, aber auch die Wahrnehmung, dass im öffentlichen Leben nicht mehr viel gelingt und die Probleme nicht gelöst, sondern nur verschoben oder allenfalls zögerlich angegangen werden, haben sich in den Köpfen festgesetzt. Das gilt auch im Privaten. Dort spüren wir steigende Preise und Zinsen, zu heiße Sommer, Versorgungsengpässe – zum Beispiel bei Medikamenten, Arbeitskräftemangel, nicht funktionierende Verkehrssysteme, Wohnungsnot, fehlendes Modernisierungstempo usw. Tatsächlich gibt es zahlreiche Gelingensstörungen, im Kleinen wie im Großen. Davon erzählen wir alle gerne. Dabei ist die Fokussierung auf das Misslingen zutiefst ungesund. Auf Dauer erschöpft sie das Selbst, macht unfroh und resignativ, in anderen Fällen auch aggressiv, sie beschädigt soziale Gemeinschaften und den Gemeinsinn.
Einige haben die zerstörerische Wirkung des negativen Blicks inzwischen erkannt und betreiben deswegen informationellen Konsumverzicht durch „Nachrichtenfasten“. Was manche als Rückzug ins Private kritisieren, hat bei Lichte betrachtet durchaus einen rationalen Kern. Warum soll ich mich mit Dingen belasten, auf die ich doch keinerlei Einfluss habe und die mir nur den Tag versauen? Umso drängender stellt sich die Frage: Wo bleibt das Gelingen? Der Blick darauf ist uns leider ziemlich verstellt. Die negative innere Brille macht, dass wir das Gelingen oft gar nicht mehr wahrnehmen. Und wo die Dinge nicht wahrgenommen werden, wird erst recht nicht darüber gesprochen. Hinzu kommt, dass es viel einfacher ist über Negatives zu sprechen als über Positives. Das Negative hat seine eigene Evidenz. Es erscheint häufig weniger begründungsbedürftig als das Positive und wird oft auch noch aufgeklärt-kritisch verpackt. Außerdem bleibt das Negative viel stärker im Gedächtnis haften. Daneben gibt es auch noch eine Art psychischen Sekundärgewinn. Es kann enorm verbindend sein, wenn man sich gemeinsam über alle möglichen Missstände aufregt. Negativität schafft, jedenfalls vordergründig, soziale Einigkeit, nicht nur unter Wutbürgern.
Dabei liegt es auf der Hand, dass wir viel mehr vom Gelingen sprechen und uns gegenseitig davon erzählen sollten. Das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern eher mit psychischer Gesundheit. Dafür müsste man sich allerdings erst einmal von der eigenen negativen Brille befreien. Und außerdem: Wie kann man vom Gelingen erzählen, ohne deswegen einfältig oder konkurrenzbewusst-auftrumpfend zu erscheinen? Und selbst ohne nerviges Triumphgehabe muss der Betroffene in unserer Gesellschaft den Neid der weniger Glücklichen fürchten. Zeigt: Es kann durchaus sozial riskant sein, aus dem gängigen Erzählmodus der Negativität auszubrechen.
Und dennoch, die Ödnis der negativen Brille muss überwunden werden, im Interesse jeder und jedes Einzelnen, aber auch der Gesellschaft als Ganzes. Wie kann das gelingen? Ein möglicher Ansatzpunkt ist die Ja-Aber-Methode. Ja, es stimmt, vieles ist wirklich nicht so, wie es sein sollte. Aber vieles ist auch bei Weitem nicht so schrecklich und so hoffnungslos, wie es häufig, mit entsprechendem „Framing“ durch Wort, Bild und Ton unterlegt, medial verkauft wird. Die Fakten sprechen mitunter eine ganz andere Sprache. Maß nehmen sollten wir an Pionieren des klaren Denkens, beispielsweise an Steven Pinker oder Hans Rosling („Factfulness“). Die Verbesserung von Luft- und Wasserqualitäten, die Bekämpfung von Ozonloch und saurem Regen, die schnelle Entwicklung von Corona-Impfstoffen sind Erfolgsgeschichten. Die gibt es ganz oft auch in kleineren Maßstäben, zum Beispiel bei der Entwicklung neuer effizienter Heizsysteme auch für Altbauten. Davon sollten wir jedenfalls auch erzählen, und nicht zuletzt die ganz persönlichen Geschichten des Gelingens.
Es geht nicht darum, Misslingen und Leid einfach zu ignorieren und auszublenden. Wohl aber geht es um Gegengewichte zum herrschenden Erzählmodus des Misslingens, um den einseitig-negativen Blick positiv zu ergänzen und zu korrigieren. Nur so haben wir auch die Chance auf ein angemessenes Bild von Wirklichkeit, was in einer Demokratie absolut „systemrelevant“ ist. Im eigenen Bekanntenkreis kann man danach fragen, was gut läuft. Und wenn Sie mal wieder an eine Person der erregten Negativität geraten, versuchen Sie es mal mit der Ja–Aber-Methode. Erwarten Sie nicht unbedingt Zustimmung oder gar ein Umdenken bei Ihrem Gegenüber, aber tun Sie es mindestens für sich selbst, als Akt seelischer Hygiene und Gesundheit. Lasst uns mehr vom Gelingen erzählen – und darauf vertrauen, dass es genug Menschen gibt, die ebenfalls Geschichten vom Gelingen erzählen können.
von Christof Gramm | Feb 21, 2024 | Allgemein
Auch wenn die Grenzen mitunter fließend sind, gibt es in unserer nationalen Presselandschaft Kommentare zu Hauf, wohingegen die literarische Gattung des Essays in Deutschland nicht besonders hoch im Kurs steht. Das ist kein Zufall, sondern hat Gründe, wenn auch keine guten.
In einem Essay stellt der Autor Betrachtungen an und schildert dabei seine persönliche Sicht der Dinge. Es geht nicht so sehr um das Was der Erörterung – prinzipiell kann jedes Thema Gegenstand eines Essays sein –, sondern um das Wie. Die Perspektive ist bewusst und gewollt eine subjektive. Hier spricht ein Einzelner aus dem Geist der Freiheit, nicht der Platzhalter einer bestimmten Organisation, einer Ideologie oder einer sonstigen Weltanschauung. Im Vordergrund steht die eigene Sichtweise.
Vielen ist das zu wenig. Sie erwarten eine abgerundete und institutionell, ideologisch oder religiös eingebettete Positionierung, die eine Zuordnung und Kategorisierung des Gesagten erlaubt. Hinzu kommt, dass der oder die Einzelne vielen als zu uninteressant gilt. Im Lande der Dichter und Denker muss es schon etwas Grundsätzlicheres, etwas Repräsentatives, Allgemeingültiges und über den Dingen Stehendes sein, um es überhaupt zu verdienen, zur Sprache gebracht zu werden.
Wer es gerne „grundsätzlich“ mag, erwartet eine erhellende, irgendwie objektive Weltenerklärung, die mehr darstellt als eine bloß persönliche Sicht der Dinge. Es ist kein Zufall, wenn unsere Kommentarlandschaft in nahezu allen öffentlichen Medien von einer Kultur der Weltendeuter, Oberversteher und Sinngeber geprägt ist. Der Grundbass lautet oft genug weniger „ich aber meine“ als vielmehr im Verkündungs- und Urteilsmodus: „ich aber sage Euch“.
Dabei macht es bei bewertenden Betrachtungen einen substantiellen Unterschied, ob jemand sagt „ich meine“ oder aber „das ist so“. In der ersten Haltung ist die Relativierung der eigenen Position eingepreist: Ich meine, aber mir ist klar, dass andere das keineswegs genau so sehen müssen. Dennoch lohnt es sich, darüber zu reden. Denn wo freie Menschen aufeinandertreffen, gibt es keine Alternative zum miteinander reden, wenn es nicht in wechselseitiges Belehren ausarten soll: Das ist so und nicht anders.
Die letztgenannte Haltung sieht sich hingegen oft genug als Protagonist einer höheren Idee und fühlt sich darin erhaben. Respekt vor anderen Sichtweisen ist dabei nicht mitgedacht, sondern es herrscht der Geist des Obsiegens und der Durchsetzung der eigenen Position. Schlimm genug ist insbesondere in vielen sozialen Netzwerken der Ton rotzig, missachtend, manchmal bösartig und hasserfüllt.
Misstrauen gegenüber dem Essay als einer dezidierten Ausdrucksform des Subjektiven erweist sich damit im Kern als Geringschätzung des Einzelnen. Das ist auch deswegen bedauerlich, weil die Form des Essays keineswegs gleichbedeutend mit Beliebigkeit ist. Die Form der subjektiven Haltung bedingt vielmehr gerade die Zurücknahme des eigenen Ichs, daher auch einen Grundrespekt vor anderen Sichtweisen: Ich meine zwar, dass die Dinge so und so sind, ich weiß aber um den Standpunkt meiner eigenen Subjektivität und räume deswegen ein, dass ich mir dessen, was ich sage, im letzten nicht ganz sicher sein kann und dass eine andere, konträre Sichtweise nicht nur möglich, sondern möglicherweise sogar richtiger ist, weil ich etwas übersehen haben könnte. Der Essayist will die eigene Sicht der Dinge zwar entschlossen und selbstbewusst zur Geltung bringen, aber immer auch ein Gespräch anregen. Er besteht nicht auf letzten Wahrheiten, wohl aber auf der Notwendigkeit des Gesprächs.
Das alles ist natürlich nicht neu. Entdeckt und zur Meisterschaft gebracht hat diese Kunstform Michel de Montaigne (1533 – 1592). Er wollte nicht belehren, sondern die Dinge aus seinem Turm heraus betrachten und dies mit anderen teilen. Seine Essays haben eher den Charakter einer Suchbewegung. Darin liegt seine brisante Modernität. Stets spricht er dabei nicht als Kirchenmann, als Vertreter des Staates, als Anhänger einer bestimmten Ideologie oder einer Gruppe, sondern immer als Michel de Montaigne. Er braucht für seine Essays keine ichverstärkenden Autoritäten, um seine Stimme zur Geltung zu bringen. Es genügt völlig die Botschaft: Hier spricht ein freier Mann oder eine freie Frau.
Zumal in einer Zeit, in der feste Ordnungen, Institutionen und Traditionen brüchig geworden sind, in der die Vielfalt der unterschiedlichsten Lebensstile in nahezu allen Lebensbereichen geradezu explodiert und in der die Orientierung für den Einzelnen deswegen nicht gerade einfacher geworden ist, ist das Essay absolut zeitgemäß – aus Respekt vor dem Einzelnen, als Anregung für eigenes Denken und für das Gespräch miteinander, denn „wir mögen auf noch so hohe Stelzen steigen – auch auf ihnen müssen wir mit unseren eigenen Beinen gehen; und selbst auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir nur auf unserm Arsch.“ (Michel de Montaigne). Treffender kann man den Geist des Essays wohl nicht fassen. Beim Essay zählt jede Stimme, weshalb diese Form zugleich urdemokratisch ist. Auch mit Blick auf eine umfassende Krise vieler herkömmlicher Institutionen ist die Rückbesinnung auf die Freiheit des Einzelnen dringend nötig. Gründe genug, wieder mehr Essays zu verfassen. Und darüber zu sprechen.