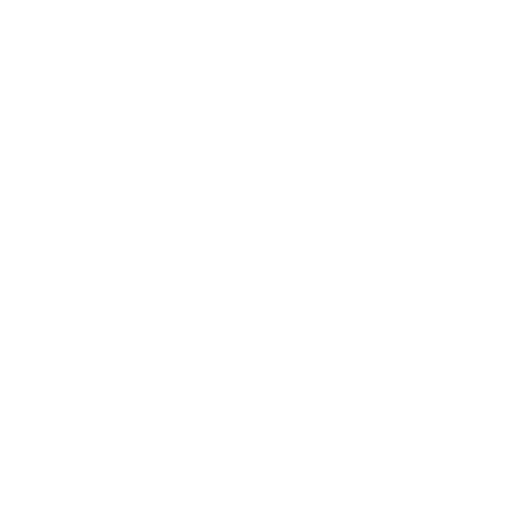von Christof Gramm | Feb 21, 2024 | Allgemein
Auch wenn die Grenzen mitunter fließend sind, gibt es in unserer nationalen Presselandschaft Kommentare zu Hauf, wohingegen die literarische Gattung des Essays in Deutschland nicht besonders hoch im Kurs steht. Das ist kein Zufall, sondern hat Gründe, wenn auch keine guten.
In einem Essay stellt der Autor Betrachtungen an und schildert dabei seine persönliche Sicht der Dinge. Es geht nicht so sehr um das Was der Erörterung – prinzipiell kann jedes Thema Gegenstand eines Essays sein –, sondern um das Wie. Die Perspektive ist bewusst und gewollt eine subjektive. Hier spricht ein Einzelner aus dem Geist der Freiheit, nicht der Platzhalter einer bestimmten Organisation, einer Ideologie oder einer sonstigen Weltanschauung. Im Vordergrund steht die eigene Sichtweise.
Vielen ist das zu wenig. Sie erwarten eine abgerundete und institutionell, ideologisch oder religiös eingebettete Positionierung, die eine Zuordnung und Kategorisierung des Gesagten erlaubt. Hinzu kommt, dass der oder die Einzelne vielen als zu uninteressant gilt. Im Lande der Dichter und Denker muss es schon etwas Grundsätzlicheres, etwas Repräsentatives, Allgemeingültiges und über den Dingen Stehendes sein, um es überhaupt zu verdienen, zur Sprache gebracht zu werden.
Wer es gerne „grundsätzlich“ mag, erwartet eine erhellende, irgendwie objektive Weltenerklärung, die mehr darstellt als eine bloß persönliche Sicht der Dinge. Es ist kein Zufall, wenn unsere Kommentarlandschaft in nahezu allen öffentlichen Medien von einer Kultur der Weltendeuter, Oberversteher und Sinngeber geprägt ist. Der Grundbass lautet oft genug weniger „ich aber meine“ als vielmehr im Verkündungs- und Urteilsmodus: „ich aber sage Euch“.
Dabei macht es bei bewertenden Betrachtungen einen substantiellen Unterschied, ob jemand sagt „ich meine“ oder aber „das ist so“. In der ersten Haltung ist die Relativierung der eigenen Position eingepreist: Ich meine, aber mir ist klar, dass andere das keineswegs genau so sehen müssen. Dennoch lohnt es sich, darüber zu reden. Denn wo freie Menschen aufeinandertreffen, gibt es keine Alternative zum miteinander reden, wenn es nicht in wechselseitiges Belehren ausarten soll: Das ist so und nicht anders.
Die letztgenannte Haltung sieht sich hingegen oft genug als Protagonist einer höheren Idee und fühlt sich darin erhaben. Respekt vor anderen Sichtweisen ist dabei nicht mitgedacht, sondern es herrscht der Geist des Obsiegens und der Durchsetzung der eigenen Position. Schlimm genug ist insbesondere in vielen sozialen Netzwerken der Ton rotzig, missachtend, manchmal bösartig und hasserfüllt.
Misstrauen gegenüber dem Essay als einer dezidierten Ausdrucksform des Subjektiven erweist sich damit im Kern als Geringschätzung des Einzelnen. Das ist auch deswegen bedauerlich, weil die Form des Essays keineswegs gleichbedeutend mit Beliebigkeit ist. Die Form der subjektiven Haltung bedingt vielmehr gerade die Zurücknahme des eigenen Ichs, daher auch einen Grundrespekt vor anderen Sichtweisen: Ich meine zwar, dass die Dinge so und so sind, ich weiß aber um den Standpunkt meiner eigenen Subjektivität und räume deswegen ein, dass ich mir dessen, was ich sage, im letzten nicht ganz sicher sein kann und dass eine andere, konträre Sichtweise nicht nur möglich, sondern möglicherweise sogar richtiger ist, weil ich etwas übersehen haben könnte. Der Essayist will die eigene Sicht der Dinge zwar entschlossen und selbstbewusst zur Geltung bringen, aber immer auch ein Gespräch anregen. Er besteht nicht auf letzten Wahrheiten, wohl aber auf der Notwendigkeit des Gesprächs.
Das alles ist natürlich nicht neu. Entdeckt und zur Meisterschaft gebracht hat diese Kunstform Michel de Montaigne (1533 – 1592). Er wollte nicht belehren, sondern die Dinge aus seinem Turm heraus betrachten und dies mit anderen teilen. Seine Essays haben eher den Charakter einer Suchbewegung. Darin liegt seine brisante Modernität. Stets spricht er dabei nicht als Kirchenmann, als Vertreter des Staates, als Anhänger einer bestimmten Ideologie oder einer Gruppe, sondern immer als Michel de Montaigne. Er braucht für seine Essays keine ichverstärkenden Autoritäten, um seine Stimme zur Geltung zu bringen. Es genügt völlig die Botschaft: Hier spricht ein freier Mann oder eine freie Frau.
Zumal in einer Zeit, in der feste Ordnungen, Institutionen und Traditionen brüchig geworden sind, in der die Vielfalt der unterschiedlichsten Lebensstile in nahezu allen Lebensbereichen geradezu explodiert und in der die Orientierung für den Einzelnen deswegen nicht gerade einfacher geworden ist, ist das Essay absolut zeitgemäß – aus Respekt vor dem Einzelnen, als Anregung für eigenes Denken und für das Gespräch miteinander, denn „wir mögen auf noch so hohe Stelzen steigen – auch auf ihnen müssen wir mit unseren eigenen Beinen gehen; und selbst auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir nur auf unserm Arsch.“ (Michel de Montaigne). Treffender kann man den Geist des Essays wohl nicht fassen. Beim Essay zählt jede Stimme, weshalb diese Form zugleich urdemokratisch ist. Auch mit Blick auf eine umfassende Krise vieler herkömmlicher Institutionen ist die Rückbesinnung auf die Freiheit des Einzelnen dringend nötig. Gründe genug, wieder mehr Essays zu verfassen. Und darüber zu sprechen.
von Christof Gramm | Feb 5, 2024 | Allgemein
Wenn es stimmt, dass die Fähigkeit zum Mitgefühl nicht nur die Wurzel aller Moral ist (Schopenhauer), sondern den Menschen erst zum Menschen macht, kommt es entscheidend darauf an, diese Fähigkeit zu schulen und zu entwickeln.
Das Mitgefühl ist allerdings nicht auf einzelne Menschen beschränkt, sondern es kann weit darüber hinaus reichen und sich auf Gruppen, aber auch auf soziale Zusammenhänge, auf Texte, auf Kunst und ganze Kulturen erstrecken. Freilich spricht man dann eher von Empathie. Wer es versteht, sich in andere Menschen und Kulturen einzufühlen, kann die beglückende Erfahrung machen, das, was zunächst fremd erscheinen mag, besser zu erfassen, zu verstehen, vielleicht sogar schätzen zu lernen, und genau dadurch das Fremde zu überwinden und Zäune zu durchbrechen. Erst die Kunst des Verstehens und damit des sich in Menschen und Dinge Einfühlens öffnet andere Welten. Wer hingegen in allem stets nur das immer schon Be- und Erkannte sieht, erstarrt irgendwann im eigenen Biedersinn.
Die Aneignung des Fremden durch die Kunst des Verstehens und der Empathie halte ich für eine fundamentale, aber bedrohte Kulturtechnik. Stets wurde sie durch den ewigen Spießer verurteilt, und neuerdings durch die sogenannte Identitätspolitik. Unter dem vorgeblichen Respekt für andere Lebensweisen und Lebensformen, insbesondere von Minderheiten, und der Heiligung des Fremden gilt kulturelle Aneignung als schwere Straftat oder als rassistisch. Insbesondere gelten Vermischung und Vermengung kultureller Attribute unterschiedlicher Herkunft als unrein, als moralisch unzulässige Herrschaftsausübung und Unterdrückungstechnik.
Gerade kreative Prozesse beruhen aber sehr oft auf der Aneignung und Umarbeitung fremder kultureller Einflüsse. Das gilt für Musik, Kunst und Sprache, aber auch für andere geistige Prozesse und selbst für die Küche. Die allermeisten Kulturen mischen verschiedene Elemente, und nicht immer geschieht das respektvoll. Es gibt sogar Gattungen, die aus der Respektlosigkeit eine Kunst machen, Satire und Karikatur gehören dazu, auch der schwarze Humor von Monty Python (Das Leben des Brian) und nicht zuletzt der Karneval. Das Grelle und Überzeichnende muss man nicht immer gut finden, aber der Verzicht auf solche Formen bahnt den Weg in die Unfreiheit. Nicht umsonst stehen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit, aber auch die Kunstfreiheit unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes.
Genau dies will die sogenannte Identitätspolitik abschaffen. Im Bewusstsein und in der Selbstzufriedenheit der eigenen moralischen Überlegenheit entsteht eine neue Lebensenge, die nicht verbindet, sondern auf Trennung und Reinheit der Formen besteht. Toleranz ist in dieser Welt nicht vorgesehen, sondern Verurteilung jeglicher Form der kulturellen Vermischung und Vermengung als rassistisch, ausbeuterisch, bevormundend und dergleichen mehr.
Ich meine, dass auf diese Weise im Gestus moralischer Feinfühligkeit neue Gefängnisse errichtet werden, die zu Ende gedacht in der völligen Vereinzelung der Menschen landen werden, weil nur dann wahre Authentizität gewährleistet ist. Der Gestus identitärer Überlegenheit unterliegt damit einem doppelten Irrtum. Einerseits verkennt er, dass Fortschritt und Kreativität sehr oft von Anleihen leben, und andererseits denkt er seine Position nicht zu Ende. Nicht weltoffen und neugierig, sondern abgrenzend und verschlossen, nicht fröhlich und witzig, sondern empört und verurteilend schaffen Identitätsbesessene die offene Gesellschaft ab.
Dahinter steckt auch ein grundlegender Irrtum über die Freiheit. Freiheit ist kein Garant dafür, nie verletzt zu werden. In gewissem Umfang müssen wir alle, wenn wir friedlich zusammenleben wollen, die Freiheitsausübung der anderen erdulden, auch wenn es uns nicht passt und wir es nicht nur als lästig, sondern mitunter als verletzend empfinden. Andere dürfen uns bewerten, sich vielleicht sogar lustig über uns machen, sich unserer Sichtweisen und Symbole bedienen oder uns ablehnen, jedenfalls in gewissen Grenzen. Da, wo diese Grenzen zu eng gezogen werden, beginnt bald der Tugendterror.
Ich rede damit ausdrücklich nicht der Freiheit das Wort, seinen Hass in den sozialen Netzwerken ungefiltert und ungestraft zu verbreiten, wohl aber einem mit Augenmaß betriebenen leben und leben lassen. Um die Einstellung dieses Augenmaßes geht es, und richtig ist auch, dass jede neue Generation das Recht hat, ihr Augenmaß neu zu justieren. Sicher sind wir in vielen Bereichen heute im Großen und Ganzen sensibler als vor 30 Jahren, was sich beispielsweise an der Witze-Kultur leicht ablesen lässt. Ostfriesenwitze, Blondinenwitze oder Türkenwitze sind heute nur noch peinlich und werden zu Recht als diskriminierend empfunden.
Das Recht auf kulturelle Aneignung lasse ich mir deswegen aber nicht nehmen. Es ist eine Bereicherung und ein Glück, fremde Kulturen und Sichtwiesen aufgreifen und verarbeiten zu dürfen, selbst wenn das manchmal nur oberflächlich sein mag. Auch im Imitat kann ich nichts Schlechtes erkennen, zumal jedes Lernen zu Beginn ein Imitieren ist. Wer das nicht versteht und darin nur Unterdrückung und Niedertracht erkennt, wird bald ziemlich einsam sein. Und wie sich auf diese Weise echtes Mitgefühl für andere herausbilden kann, erschließt sich mir nicht.
von Christof Gramm | Jan 31, 2024 | Allgemein
Das Potsdamer Treffen zur sogenannten Remigration hat in weiten Teilen unseres Landes Demonstrationen gegen die AfD ausgelöst. Bürgerinnen und Bürger stellen sich die Frage „dabei sein oder nicht“. Aktuell findet ein gesellschaftlicher Sortierprozess statt, bei dem viele sich positionieren. Mit dem Mut zur Vereinfachung kann man dabei drei „Körbchen“ unterscheiden.
Im ersten Körbchen befinden sich die AfD Anhänger, ihre Sympathisanten, die von der Politik Enttäuschten, die Wütenden, Menschen, die sich mehr nach der Vergangenheit als nach der Zukunft sehnen, politische Denkzettelverteiler – und eindeutige Nazis. Im zweiten Körbchen sammelt sich eine bunte gesellschaftliche Mischung, die aus ganz unterschiedlichen Beweggründen in der Ablehnung völkischen Gedankenguts einig ist. Diese Gruppe versteht sich als breite gesellschaftliche Mitte und beruft sich vehement auf das Grundgesetz. Dabei gibt es allerdings auch Eiferer, die über das Ziel hinausschießen und pauschal „gegen rechts“ ideologisieren. Zur Erinnerung: Rechts darf man unter dem GG sein. Rechts ist nicht gleich Nazi. Dies auseinanderzuhalten ist demokratische Pflicht, auch für Linke. Das dritte Körbchen ist wohl am schwierigsten zu fassen. Hier einigt Gleichgültigkeit die gesellschaftlichen Kräfte. Es sind die Distanzierten, die „geht mich nix an Gemeinde“ und die nur um sich selbst Kreisenden, die gar nicht selten zugleich ziemlich wohlhabend sind. In England hat man diese Leute zu Zeiten des Brexits die „anywheres“ genannt (meint: Sie können sich überall in ein neues Zuhause einkaufen). In Deutschland passt vielleicht das Bild vom Zauberberg, auf dem die Wohlhabenden, die meinen, über den – politischen – Dingen zu stehen, sich komfortabel eingerichtet haben.
Meine These: Freiheitliche Gesellschaften scheitern in Wahrheit nur selten an ihren Gegnern, sondern zumeist am dritten Körbchen, also an denjenigen, die meinen sich heraus halten zu können. Rafik Schami hat das auf den Punkt gebracht: „Es gibt kaum eine Gruppe, die so viel Einfluss auf die Weltgeschichte hat wie die Gleichgültigen. Und das Bemerkenswerte daran ist, niemand spricht von ihnen. Ihre Passivität hat die radikalsten Umbrüche ermöglicht.“
Wer nicht gleichgültig ist, muss deswegen kein Revolutionär sein. In meinem demokratischen Basisbewusstsein gilt: Auch wenn wir uns nicht darüber einig sind, wohin wir politisch wollen, und auch wenn wir uns darüber zu unser aller Glück auch gar nicht einig sein müssen, so sollten wir doch darin übereinstimmen, wohin wir ganz entschieden nicht wollen. Diese Verbundenheit gründet keineswegs nur auf Ablehnung, sondern im letzten auf dem wechselseitigen Respekt und der Idee der Menschenwürde, die viele unterschiedliche Lebensformen gestattet. Aber nicht alle. Völkische Vorstellungen sind mit dem Grundgesetz unvereinbar. Unsere Verfassung errichtet deswegen eine wehrhafte, das heißt eine nicht-gleichgültige Demokratie. Die freiheitliche Welt besteht zwar oft mehr aus einem Nebeneinander als aus einem Miteinander ihrer Mitglieder. In ihr finden viele konkurrierende politische Projekte ihren Platz, aber kein völkisches Gedankengut. Dafür stehen allerdings viele in der AfD. Wer sich trotzdem hinter die AfD stellt muss wissen, dass er die Naziideologie der menschenverachtenden Ausgrenzung und des Hasses mit einkauft. Und wer davor die Augen verschließt übersieht, dass die AfD unserer freiheitlichen Demokratie den Kampf erklärt hat. Das schließt nicht aus, dass es im Programm der Partei auch einige Punkte geben mag, über die man diskutieren kann. Aber wer das eine will, der wird auch das andere bekommen. AfD ohne Naziideologie gibt es nicht. Und genau das ist der Grund dafür, dass die sonst eher träge und unsichtbare breite Mitte sich plötzlich vernehmbar macht und ihr Lebensmodell hochhält. Illusionen sollte man sich deswegen trotzdem nicht machen. Die in der Wolle gefärbten AfD-Sympathisanten wird man damit nicht zurückgewinnen, und einige werden auf den Wind, der ihnen entgegenschlägt, vorhersehbar trotzig reagieren. Dann ist das eben so. Das kann aber kein Grund dafür sein, sich vornehm zurückzuhalten. Viel wichtiger ist, was an anderer Stelle passiert. Vielleicht wacht der eine oder die andere im dritten Körbchen auf, bevor es ihm oder ihr ergeht wie großen Teilen der britischen Jugend beim Brexit. Die haben damals das Thema aus Desinteresse und Borniertheit schlicht verpennt. Wer sich nicht kümmert, wenn es darauf ankommt, und sich stattdessen lieber privat amüsiert, hat politisch gesehen eben Pech. Das kann leider zu Lasten von uns allen gehen, auch Demokratien sind Schicksalsgemeinschaften.
Das Grundgesetz gewährt um der Freiheit willen zwar das Recht gleichgültig zu sein und sich herauszuhalten. Das Paradoxe daran: Eine offene Gesellschaft lebt davon, dass es trotzdem genügend Menschen gibt die wissen, wann sie politisch gefordert sind. Mit Einheitsfront oder politischer Gleichschaltung hat das nichts zu tun, sondern im Gegenteil. Frei bleibt auf Dauer nur, wer um die Vielfalt und die Verletzlichkeit der Freiheit weiß. Und wer seinen Beitrag zur Erhaltung eben dieser Freiheit leistet, wenn es darauf ankommt. Wenn Nazis sich anschicken, das Ruder in unserem Land zu übernehmen, kommt es darauf an.
von Christof Gramm | Nov 30, 2023 | Allgemein
Dass die Welt weniger berechenbar ist als noch vor rund 15 Jahren, ist eine Binse. Wir erleben, dass uns viele vermeintliche Gewissheiten zwischen den Fingern zerrinnen. Das gilt im Großen, auf der politischen Bühne des Weltgeschehens – „von Freunden umzingelt“ war einmal -, aber auch in unserer kleinen persönlichen Welt. Auch wenn es den meisten von uns sehr gut geht: Vieles erscheint brüchiger, gefährdeter und unfriedlicher als früher. Die Illusion, dass man selbst irgendwie mitsteuern könnte, nimmt ab. Für eine Demokratie ist das nicht ungefährlich. Gewissheitsverluste führen zu Verunsicherung, und das macht vielen Angst. Das wiederum spielt radikalen Kräften in die Hände, die diese Verunsicherung nach Kräften bespielen, mit wachsendem politischem Erfolg, und das nicht nur in Deutschland. Aber nicht nur ehemals feste Gewissheiten verschwinden. Es beginnt bereits viel früher, nämlich beim Verstehen der Welt. Die Komplexität des gesamten Lebens hat enorm zugenommen. Dafür muss man nicht nur in die große Politik schauen, sondern es genügt ein Blick ins alltägliche Leben. Schon so triviale Dinge wie Bankgeschäfte, Internetnutzung oder der Umgang mit Behörden und Versicherungen können echte Herausforderungen darstellen. Und Besserung ist nicht in Sicht. Die Veränderungsgeschwindigkeit in unserer Welt nimmt beständig zu. Dass es in einer komplizierten Welt kein leichtes Verstehen, und erst recht keine einfachen Lösungen geben kann, liegt zwar auf der Hand. Aber viele sehnen sich gerade deswegen genau nach solchen einfachen Lösungen.
Gewissheitsverluste und Verstehensdefizite sind allerdings noch nicht alle Verlustposten. Schwer wiegen auch Vertrauensverluste in politische, staatliche und gesellschaftliche Institutionen, wie beispielsweise die Kirchen, sowie persönliche Orientierungsverluste – selbst das eigene Geschlecht ist zunehmend nicht mehr eindeutig. Die Generationen der Jetzt-Zeit sind vor die Herausforderung gestellt, mit wachsenden Unsicherheiten zu leben. Sicher ist, dass viele Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Verlustresistenz gehört allerdings nicht unbedingt zu unseren kollektiv gut ausgebauten Fähigkeiten. Wo überkommene Gewissheiten, Weltverstehen, Vertrauen und eigene Orientierung abnehmen, stellt sich umso drängender die Frage: An welchen Eckpunkten kann ich mich ausrichten, und woran kann ich mich festhalten, persönlich, gesellschaftlich und politisch? Hinzu kommt, dass viele Propheten des Untergangs derzeit kräftig ins Horn stoßen, insbesondere beim Klima, bei der Energieversorgung, beim Wohlstand oder beim Frieden. Das macht die Sache nicht besser. Orientierung bleibt Mangelware. Die Regierenden, vornehmlich der Bundeskanzler, leisten sie jedenfalls nicht, und den Kirchen laufen ihre Mitglieder davon. Aber nicht alle radikalisieren sich. Viele ziehen sich einfach zurück, manche eher resigniert bis depressiv, manche entschlossen in Zielrichtung private Glücksmaximierung: „Machen wir es uns eben zu Hause mit Familie und Freunden schön und gemütlich“. Wieder andere stürzen sich in einen eher beliebigen Aktionismus und eilen atemlos von Event zu Event. Orientierung und Sinn stiftet das zwar nicht unbedingt, aber immerhin das Gefühl, dass „etwas“ geschieht. Auch wenn das jetzt sehr holzschnittartig gezeichnet ist, sind die vier großen Verlustposten Gewissheiten, Weltverstehen, Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen und in die Zukunft sowie persönliche Orientierung kaum von der Hand zu weisen. Wo private Verluste noch dazu kommen, verschärft sich das Ganze. Wie kann man damit umgehen?
Ich schaue ein paar Generationen zurück. Meine Großmutter, Jahrgang 1902, hat mehrere Reiche, Republiken, Armut, Inflationen und nicht zuletzt zwei Weltkriege erlebt. Spätestens ab 1918 gab es keine Gewissheiten mehr, jedenfalls keine angenehmen. Sie wurde dennoch eine starke Frau. Als Kriegswaise hat sie unter großen persönlichen Verlusten und Entbehrungen ihre Familie gegründet und mit viel Energie und Klugheit lebenstüchtig gemacht. Eher der SPD zugeneigt, realitätsnah und nüchtern, ohne übertriebene Frömmigkeit, aber im christlichen Glauben verwurzelt, hat sie ihr Leben gemeistert. Die Zuversicht, gegen alle schlechten Wegzeichen der Zeit, von denen es in ihrem Leben eine Menge gab, war vielleicht ihre wichtigste Gabe. Das Gegenteil von Zuversicht ist Resignation. Oder Realitätsflucht. Zuversicht macht resilient gegen Verluste.
Was Zuversicht im Kern bedeutet, und vor allem: wo sie eigentlich herkommt, bleibt dennoch ein Rätsel. Martin Luther hat Zuversicht in das wunderbare Bild gesetzt: „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Als Heute-Mensch frage ich mich: Woher nehmen Menschen die innere Kraft dazu, und was befähigt sie zur Zuversicht? Vielleicht sollten wir gerade in Zeiten abnehmender Gewissheiten viel mehr über die Quellen unserer Zuversicht und über unsere persönlichen Orientierungspunkte nachdenken, sie pflegen und gemeinsam darüber sprechen, ohne Radikalisierung, ohne Resignation, ohne Realitätsblindheit, und ohne die Flucht ins private Glück oder in die Beliebigkeit. Schade nur, dass ich meine Großmutter dazu nicht mehr befragen kann. Sie starb 1980. Sie war eine tolle Frau.
von Christof Gramm | Nov 14, 2023 | Allgemein
Wieviel Moral oder Ethik – zwischen beiden wird selten deutlich unterschieden – ist gut? Insbesondere: Wieviel Moral braucht die Politik, welche ethischen Maßstäbe sollen gelten? Ist beispielsweise die Frage des Schnitzelverzehrs eine moralische Frage?
Einige werden alleine schon diese Fragen als unsinnig zurückweisen, weil es aus ihrer Sicht nur eine einzige und unbedingt verbindliche Moral gibt, und zwar auch für das Schnitzel. Tatsächlich existiert aber nicht nur die eine Moral, sondern eine ganze Reihe unterschiedlicher, miteinander durchaus konkurrierender „Moralen“ – und dementsprechend unterschiedliche moralische Maßstäbe. Geläufig sind beispielsweise Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, rigoristische Ethik oder utilitaristische Ethik. Überlagernd, aber nicht deckungsgleich hinzu kommen rechtliche Maßstäbe, insbesondere die aus unserer Verfassung.
Tatsächlich verändern sich moralische ebenso wie rechtliche Standards häufig im Laufe der Zeit. Das gilt auch im öffentlichen Raum. Nicht nur rechtliche Maßstäbe werden permanent verfeinert, sondern auch die moralischen Ansprüche sind in den letzten Jahren massiv angestiegen – zB bei Fragen der Generationengerechtigkeit, der Klimagerechtigkeit, der Geschlechtervielfalt, des Genderns, der kulturellen Aneignung, der Energieversorgung, der Migrantenströme, des (Alltags-) Rassismus und Kolonialismus, der Ernährung, des Tierwohls, des Naturschutzes, der Errichtung von Windrädern etc. Es gibt kaum einen Lebensbereich, an den nicht hohe moralische Messlatten angelegt werden. „Cancel culture“ oder Klimaleber sind nur zwei aus diesem moralischen Wachstum abgeleiteten praktischen Konsequenzen.
Moralisches Wachstum fühlt sich für viele attraktiv an. Wer das Recht und die Moral auf seiner Seite weiß, fühlt sich gleich doppelt gerechtfertigt. Ein wichtiger Effekt dieser Entwicklung: Sach- und Fachfragen werden dadurch zu moralischen Fragen umdefiniert und als solche diskutiert. Die Klimakrise werden wir allerdings mit noch so viel Moral kaum lösen. Was die moralisch besonders Aufgeklärten dabei häufig nicht sehen: Die Moralisierung nahezu aller Lebensbereiche führt in einer Demokratie zu einer riskanten gesellschaftlichen Verhärtung, in der es kaum mehr Zwischenzonen des politischen Handels im Sinne eines abwägenden „Mehr oder Weniger“ geben kann. Das gilt umso mehr, weil unsere Handlungsressourcen häufig nicht in gleicher Weise mit den moralischen Ansprüchen mitgewachsen sind.
Es ist deswegen wenig überraschend, dass die moralischen Maßstäbe in der Bevölkerung teilweise deutlich auseinanderlaufen und sich gesellschaftliche Gräben auftun. Die Frage nach dem korrekten Schnitzelverzehr ist da noch eines der harmloseren Themen. Das Wachstum der moralischen Ansprüche und eine daraus resultierende entschlossene Intoleranz einerseits bestärkt wiederum die anderen in ihrer tiefen Ablehnung und nicht minder entschlossenen Intoleranz. Sehr deutlich sieht man das in den USA, wo die auch in moralischer Hinsicht grobschlächtige Trump-Welt auf die filigranen moralischen Lebenswelten mit extrem strengen Maßstäben von „linken Eliten“ trifft, die insbesondere an den Universitäten gelten. Das vertieft die Gräben. Die Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber.
Keine Frage, Streit gehört zur freiheitlichen Gesellschaft unbedingt dazu. Das gilt auch für moralische Fragen. Wir sollten uns allerdings vor moralischen Zuspitzungen hüten, wie sie derzeit auf manchen Gebieten zu beobachten sind. Vor allem sollten wir uns davor hüten, jede gesellschaftliche Streitfrage zu einer moralisch Auseinandersetzung hochzuzonen, bei der es letztlich nur noch ein apodiktisches „entweder – oder“ gibt. Es existieren dann nur noch Freunde oder Feinde. Das schadet unserer Gesellschaft und bringt uns möglichen Lösungen nicht näher. Um beim vergleichsweise harmlosen Schnitzelbeispiel zu bleiben: Mit der schrittweisen Verbesserung der Haltungsbedingungen für Tiere ist zwar nicht alles, aber doch eine Menge gewonnen. Dabei müssen schärfere moralische Standards und strengere rechtliche Regelungen Hand in Hand gehen. Dass moralische Standards häufig strenger sind als das geltende Recht, ist auch eine Bedingung des Fortschritts von Recht. Häufig sind bestimmte moralische Erwartungen von heute das geltende Recht von morgen. Das ist weder neu noch beunruhigend, ganz im Gegenteil. Zu warnen ist allerdings vor einer moralischen Überforderung der rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten und vor allem vor der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz einer elitären Moral. Für alle wäre wenig gewonnen, wenn besonders fortschrittliche Moralisten und eher traditionelle Kreise sich nicht mehr verständigen können. Den Preis dafür zahlen alle. Gestärkt werden dadurch die gesellschaftlichen Ränder. Das schlägt sich irgendwann auch im Wahlverhalten nieder. Daran kann die in unserem Land traditionell starke bürgerliche Mitte kein Interesse haben. Etwas weniger Moral wäre gerade heute durchaus hilfreich. Vor moral overkill wird gewarnt.
von Christof Gramm | Nov 10, 2023 | Allgemein
Um das Wort Gemütlichkeit beneiden uns manche Ausländer, weil es das in ihren Sprachen gar nicht gibt. Auch ähnliche Begriffe, wie beispielsweise das Dänische HYGGE, meinen nicht genau das Gleiche. Und erst recht beneiden uns andere um das, was wir damit verbinden – Weihnachten und Weihnachtsmärkte zum Beispiel, bestimmte Gerüche, aber auch ein gemütliches und „anheimelndes“ zu Hause. Gemütlichkeit ist ein sehr deutscher Sehnsuchtsort, mit leicht utopischem Beiklang. Dabei ist Gemütlichkeit viel mehr als ein Gefühl. Es ist ein glücksnaher Seelenzustand, eine Form des In-der-Welt-Seins, die nach Ruhepol und nach Geborgenheit in einer unsicheren Welt klingt, nach Aufgehobensein, Behaglichkeit und Herzlichkeit. Die hässlichen Seiten der Welt bleiben dabei draußen vor der Tür. Notfalls kann man es sich sogar alleine gemütlich machen, aber schöner ist es, diesen Zustand mit anderen zu teilen. Entsprechende Bilder geraten mitunter zwar etwas süßlich, manchmal auch puppig oder spießig, und gerne auch alkoholfreudig – „ein Prosit der Gemütlichkeit“. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den Vorstellungen von Gemütlichkeit oft etwas Verheißungsvolles mitschwingt, das uns an das Glück der Kindheit erinnert. Da, wo es gemütlich wird, ist das verlorene Paradies immerhin ein bisschen greifbarer als sonst.
Und weil das so ist, bleibt Gemütlichkeit immer auch zwiespältig, jedenfalls aber zerbrechlich, und sie kann nach hinten losgehen. Wir kennen das von Weihnachten. Erst freuen sich alle darauf, aber nach ein paar Tagen reicht es dann und man geht sich auf die Nerven. Als herbeigezwungener Dauerzustand kann Gemütlichkeit regelrecht zum Psychoterror mutieren. Heinrich Böll hat das in seiner Erzählung „Nicht nur zur Weihnachtszeit“, bei der eine Familie sich ganzjährig täglich zur Weihnachtsfeier versammeln muss, satirisch auf die Spitze getrieben. Ungeachtet solcher Umschlagspunkte hat Gemütlichkeit gerade in schwierigen Zeiten Konjunktur. Wo Krieg, Zerstörung, Vertreibung und Flucht, Hunger, Krankheiten und Klimakatastrophen die öffentlichen Bilder prägen, steigt bei vielen das Bedürfnis nach Gemütlichkeit. Verstärkt wird diese Sehnsucht durch das eher resignative Gefühl, dass man ja sowieso nichts machen und schon gar nichts ändern kann. Je mehr die Welt uns überfordert, um so stärker wünschen wir uns in die Schutzzone der Gemütlichkeit hinein. Dieser Wunsch wird hier keineswegs kritisiert. Er wirft aber die Frage auf, ob wir uns glückstechnisch gesehen eher in die Richtung des „Rückzugs ins Private“ bewegen. Wir kennen das – wenn auch unter politisch und gesellschaftlich ganz anderen Vorzeichen – beispielsweise aus dem Biedermeier oder auch aus der späten DDR, Stichwort „Nischengesellschaft“. Man sucht das Glück umso stärker in der privaten Welt, je bedrückender wir die öffentliche Welt erleben. Einige Soziologen und Sozialpsychologen bescheinigen uns politische Erschöpfung, vielleicht sogar kollektive Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst. Und tatsächlich dürften viele Menschen das politische Lebensgefühl teilen „so kann es nicht weitergehen“. Allerdings ziehen sie ganz unterschiedliche Schlüsse daraus. Die einen werden zu Wutbürgern oder radikalisieren sich, andere schlussfolgern „machen wir es uns eben zu Hause gemütlich“.
So verständlich dieser Wunsch sein mag, zeigt er auch eine Risikozone auf. Gemütlichkeit kann in Blindheit und Selbstzufriedenheit umschlagen, erst recht, wenn sie mit Wohlstand verknüpft ist, ungefähr so: Uns geht´s doch gut, habe ich mir verdient, lass ich mir von niemandem vermiesen, unangenehmes ausblenden und ungestört genießen. Welt, lass uns in Ruhe. Wir genügen uns selbst. Hauptsache gemütlich. Und schon sitzen wir in der Gemütlichkeitsfalle.
Keine Frage, wir alle brauchen Rückzugsräume, Ruhezonen und Auszeiten von der Wirklichkeit, insbesondere wenn sie uns – öffentlich oder privat – hässlich und fürchterlich begegnet. Kritisch wird es meines Erachtens dann, wenn wir alles das, was eben nicht gemütlich ist, ausgrenzen und die Begegnung damit vermeiden. Das gilt für Themen, aber auch für Menschen. Der Preis dafür ist kein geringer. Im Extremfall bedeutet Gemütlichkeitskult Weltverlust und Isolation. Die Wirklichkeit lässt sich aber nicht betrügen oder beliebig umdeuten. Sie holt uns immer wieder ein, privat, aber auch politisch, erst recht in einer globalisierten Welt. Das Ausblenden der unangenehmen Themen und die Flucht in die Gemütlichkeit helfen allenfalls auf Zeit. Auch wenn wir nicht immer etwas ändern können: Manchmal können wir mehr tun als wir meinen, privat und öffentlich. Dafür gibt es viele Bühnen: Gespräche, Versammlungen und Kundgebungen, gesellschaftliches (Ehrenamt) und politisches Engagement, Leserbriefe, Diskussionen, für manche das Gebet, und ganz allgemein ein Beitrag zur Lösung eines Problems, und sei es noch so klein. Das soll niemandem den Weihnachtsmarkt vermiesen. Erhobene moralische Zeigefinger gibt es mehr als genug in unserem Land. Bei aller Sehnsucht sollten wir uns aber die Offenheit für die Welt und die Menschen bewahren, wie sie nun mal sind, das aushalten und so gelassen wie möglich ertragen – auch dann, wenn es ungemütlich wird. Darauf einen Glühwein.